Noch ein Beitrag zur Gendern-Debatte
Sprache ist ein Kommunikationsmittel. Zuweilen Gesten und Mimik ergänzend oder selbst um diese ergänzt, soll sie (Sprache ist weiblich?) dazu dienen, unsere Gedanken und Gefühle anderen zu vermitteln, was, technisch betrachtet, nahezu völlig unmöglich is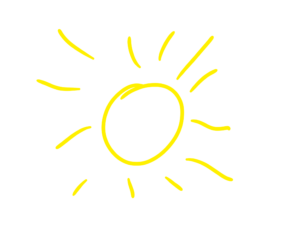 t und bestenfalls annähernd gelingen kann. Wer je versucht hat, die unfassbare Trauer und alle damit einhergehenden Gedanken und Gefühle nach einem schlimmen Verlust in Worte zu fassen, weiß, dass Sprache unzulänglich ist, ein eher schwaches Hilfsmittel, aber das beste, das uns bislang zur Verfügung steht. Eigentlich aber weiß das jeder Mensch. Und es gilt auch im umgekehrten Fall des wahnwitzigen Glücks, wenn man so große, vertraute, umfassende Nähe zu jemandem empfindet, und in vielen anderen, ganz alltäglichen Fällen, genau genommen aber: andauernd. Diese Schnittstelle zwischen uns Menschen, die die Sprache bildet, ist alles andere als perfekt, sie ist oberflächlich und vereinfachend, und je komplizierter Sachverhalte sind, je mehr man in möglichst wenigen Worten sagen will oder muss, umso schwieriger wird es, aber manchmal sind es auch ganz simple Dinge, die sich kaum ausdrücken lassen. Etwa dieses Gefühl, wenn man einen langen Schluck eiskaltes, kristallklares, leicht sprudelndes Wasser trinken konnte, nachdem man großen Durst hatte. Jeder kann sich dieses Gefühl vorstellen, aber formulieren lässt es sich nicht. Umgekehrt kann man in einfachen Worten manchmal sehr viel sagen. Und gelegentlich zu viel.
t und bestenfalls annähernd gelingen kann. Wer je versucht hat, die unfassbare Trauer und alle damit einhergehenden Gedanken und Gefühle nach einem schlimmen Verlust in Worte zu fassen, weiß, dass Sprache unzulänglich ist, ein eher schwaches Hilfsmittel, aber das beste, das uns bislang zur Verfügung steht. Eigentlich aber weiß das jeder Mensch. Und es gilt auch im umgekehrten Fall des wahnwitzigen Glücks, wenn man so große, vertraute, umfassende Nähe zu jemandem empfindet, und in vielen anderen, ganz alltäglichen Fällen, genau genommen aber: andauernd. Diese Schnittstelle zwischen uns Menschen, die die Sprache bildet, ist alles andere als perfekt, sie ist oberflächlich und vereinfachend, und je komplizierter Sachverhalte sind, je mehr man in möglichst wenigen Worten sagen will oder muss, umso schwieriger wird es, aber manchmal sind es auch ganz simple Dinge, die sich kaum ausdrücken lassen. Etwa dieses Gefühl, wenn man einen langen Schluck eiskaltes, kristallklares, leicht sprudelndes Wasser trinken konnte, nachdem man großen Durst hatte. Jeder kann sich dieses Gefühl vorstellen, aber formulieren lässt es sich nicht. Umgekehrt kann man in einfachen Worten manchmal sehr viel sagen. Und gelegentlich zu viel.
Das Gute: Alle Beteiligten wissen das, denn wir alle nutzen dieselbe Sprache. Wir wissen auch, dass unser Lächeln nie ganz genau so ist, wie das Gefühl, das wir dabei empfinden, und wir wissen auch, dass unser Gegenüber möglicherweise nicht exakt einschätzen kann, was es zu bedeuten hat. Diese Unzulänglichkeit im Umgang miteinander ist Bestandteil unseres Daseins, sie ist Quelle eines Erfahrungsschatzes, sie ist manchmal sogar Werkzeug, sie lässt Interpretationen zu und, ja, Missverständnisse, sie hat subtile Zwischentöne und bietet ganz viel Raum für Kreativität und Phantasie. Wäre Sprache perfekt, müssten Schriftsteller nicht andauernd dieselben Geschichten in unterschiedlichen Worten erzählen, denn genau das tun sie, tagein, tagaus. Es gäbe höchstens zwanzig, dreißig Bücher, weil in ihnen alles gesagt wäre.
Ich kenne alle Argumente für das Gendern, und ein paar davon sind schlüssig. Und auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass dies der richtige Weg zu einem fraglos guten Ziel ist, wird allein die Debatte darüber, wird der Diskurs (jedenfalls, wo er möglich ist und nicht unserer – derzeit stetig wachsenden – Neigung, zu fraktionieren und zu separieren, uns jederzeit klar zwischen Zustimmung und Ablehnung zu entscheiden, zum Opfer fällt) zur Folge haben, dass wir uns mehr Gedanken über nach wie vor bestehende Ungerechtigkeiten machen, gegen sie angehen und sie – möglichst gemeinsam – beseitigen.
Wir müssen endlich damit aufhören, unsere Unterschiedlichkeiten als Qualitätsmerkmale zu begreifen.
Das ist der Kern aller Problematiken, und das gilt in alle Richtungen. Es ist unfassbar und schwer zu ertragen, was vielen Menschen angetan wurde und wird, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder Unglaubens, ihres Aussehens, ihrer körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ihrer sexuellen Neigungen, ihrer ethischen Vorstellungen, ihrer politischen Überzeugungen und aus vielen anderen Gründen. All dem liegt die Annahme zugrunde, absichtlich oder oktroyiert oder unbewusst, dass diese Merkmale etwas mit Wertigkeit zu tun haben. Aber der Umstand, dass es Ungleichbehandlungen oder sogar Misshandlungen aus solchen Gründen gibt oder gab, erhebt Betroffene nicht über alle anderen Menschen. Und übrigens gibt es Zwischentöne der Diskriminierung, zuweilen sogar ziemlich laute, denen sehr, sehr viele Menschen ausgesetzt sind oder werden, ohne dass sie sich je einer vermeintlich marginalisierten Community zugehörig fühlen oder fühlen wollen (oder es eine solche überhaupt gäbe). Und ebenfalls übrigens sind nicht wenige Menschen, die diskriminiert wurden oder werden, die misshandelt oder missachtet oder benachteiligt wurden oder werden, selbst in der einen oder anderen Weise mit ihrer eigenen Unfähigkeit konfrontiert, sich dem verlockenden Gefühl, anderen überlegen zu sein oder sich so zu verhalten, zu widersetzen.
Was hat das mit Sprache zu tun? Nun, die Behauptung, dass die Sprache nicht nur Werkzeug der Diskriminierung ist, was zweifelsohne zutrifft, genauso, wie sie Werkzeug der Erhebung, Preisung und des Lobes sein kann, sondern dass sie selbst bereits diskriminiert, dass sich also das Instrument sozusagen verselbständigt hat (oder so intendiert war) und ohne Anwendung durch Menschen Diskriminierung ausübt, diese Behauptung steht im Raum und führt derzeit an vielen Orten – freiwillig oder auf mehr oder weniger sanften Druck einer gut organisierten „Öffentlichkeit“- dazu, dass gegendert wird und dass Partizipkonstruktionen angewendet werden, was nur der Anfang ist. Einfach gesagt: Die Annahme, beispielsweise Frauen wären nur „mitgemeint“, wenn ein Substantiv verwendet wird, dessen Singular im generischen Maskulin steht und diesem entspricht (der Mensch), gilt sozusagen als beschlossene Sache. Wenn ich also von Lesern spreche, von Abonnenten und Kunden, dann rede ich, so diese Annahme, in der Hauptsache von Männern, und ich meine Frauen oder Menschen, deren biologisches Geschlecht uneindeutig oder überhaupt nicht vorhanden oder im Wandel ist oder die sich ihres Geschlechts nicht sicher sind oder sein wollen, höchstens etwas herablassend, sozusagen als Minderheit, als geringer geschätztes Anhängsel mit, während ich aber in der Hauptsache von Männern rede. Diese (hier sehr verkürzt wiedergegebene) Annahme ist das Axiom, das hinter sämtlichen Bemühungen steht, die Sprache selbst gerechter zu gestalten, und bedauerlicherweise wird es inzwischen von nicht wenigen der Einfachheit halber als wahr angenommen. Wir streiten kaum mehr über solche Grundsatzfragen; die überwiegend sehr akademische Diskussion, die übrigens einen Großteil der Bevölkerung aktiv wie passiv ausschließt und dies nach meinem Dafürhalten in voller Absicht tut, hat sich längst hiervon entfernt.
Aber ich meine Frauen nicht etwas herablassend mit, wenn ich von „meinen“ Lesern spreche. Mir ist das Geschlecht meiner Leser völlig egal, und wenn ich einen Satz wie „Meine Leser mögen offensichtlich die Art und Weise, wie ich mit Sprache umgehe“ schreibe, sehe ich weder hängendes Gekröse vor mir, noch vermisse ich auf irgendeinem Bild Geschlechtsmerkmale anderer Art. Ich sehe überhaupt kein Bild von einzelnen Menschen (obwohl ich mir natürlich mehr Leser wünsche) – ich verwende einen Oberbegriff. Der alle Geschlechter einschließt, und überhaupt alle körperlichen Merkmale, und sämtliche Ethnien und Glaubensrichtungen und sexuellen Orientierungen und was weiß ich noch alles. Ich habe kein Bedürfnis, das zu präzisieren, ich muss kein Binnen-I und kein Gendersternchen verwenden, um Frauen zu signalisieren, dass sie auch meine Leser sind, denn das wissen sie selbst, denn sie sind mit dem Oberbegriff nicht mitgemeint, sondern gemeint. Es gibt keine Notwendigkeit, hier etwas explizit zu nennen, das längst Bestandteil ist. Und zwar nicht als Minderheit, als qualitativ niederwertige Gruppe darin, als marginalisiertes Anhängsel, sondern als abstrakte Person ohne Geschlecht, ohne Neigungen, ohne als Qualitätsmerkmal missverstandene Eigenschaft, als irgendwas. Leser, das sind (beliebige, irgendwelche, alle) Menschen, die Bücher lesen.
Ja, ich kenne die Beispiele. „Von zwei Ärzten war einer schwanger“ aber – wer sagt denn sowas? Genausowenig erklärt man: „Von zehn Kund*innen haben zwei ihre Penisse verletzt, als sie mit dem Staubsauger zu masturbieren versuchten“ Wo Verkürzungen und abstrakte Begriffe Sinn haben, wendet man sie an, und wo man präziser werden muss oder sein möchte (!) und wo man von konkreten Personen spricht, formuliert man anders, gerne auch ausführlicher. Aber es gibt keine Notwendigkeit, immerzu mitzuerwähnen, dass Leser oder Soldaten oder Politiker oder Soziologen oder Kandidaten oder Wähler auch weiblich sein können, oder nichtbinär, oder dick oder dünn oder idealgewichtig oder blond oder braunhaarig oder glatzköpfig oder erkrankt oder gesund oder gottesfürchtig oder atheistisch oder klug oder minder intelligent oder groß oder klein oder alt oder jung oder fortschrittlich oder konservativ oder politisch uninteressiert oder reaktionär oder fit oder schlapp oder oder oder oder oder. Es ist deshalb nicht notwendig, es mitzuerwähnen, weil es enthalten ist. Das Axiom ist falsch. Es ist nicht erkennbar enthalten, das Wort bringt all dies nicht in einer Weise zum Ausdruck, die einen daran denken lässt, wie vielschichtig und vielfältig unser Menschsein ist, aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Und hier liegt das Missverständnis. (Und darin, aber das wollte ich mir eigentlich ersparen, weil es schon häufig genug erwähnt wurde, dass Genus und Sexus nicht dasselbe sind.)
Ich weiß nicht, ob es Männer gibt, die wütend zum sonnenbeschienenen Himmel schauen, weil der größte Körper in unserem System mit einem weiblichen Artikel versehen ist, während dieses kleine Kügelchen Geröll, das die weibliche Erde umkreist, generisch männlich sein darf. Ich denke, die meisten Menschen werden sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber machen, und sie werden auch keine Wertung vornehmen: Ah, die Sonne ist besser, weil sie weiblich ist, aber der Mond ist scheiße, das ist nur ein Mann, sogar ein alter und grauer. Wir wissen, dass es drei Artikel in der deutschen Sprache gibt, und wir wenden sie an, wie wir viele Begriffe anwenden und damit in der Anwendung etwas meinen, und das ist bei denselben Worten selten immer das gleiche. Es ist uns unmöglich, das, was wir meinen, präzise in den Köpfen ankommen zu lassen, die auf den Körpern derjenigen Menschen sitzen, die unsere Äußerungen zur Kenntnis nehmen müssen.
Wir müssen ohne Zweifel viel achtsamer im Umgang miteinander sein, wir müssen anerkennen, dass es Menschen gibt, die die Geschichte geprägt haben, und andere, die dabei außenvor gelassen wurden (und dass es gegenwärtige Menschen gibt, für die beides nicht gilt). Wir müssen aber auch unsere Unzulänglichkeiten akzeptieren, und die Tatsache, dass sie durch Gruppendenken verstärkt werden. Wir müssen Meinungen respektieren und weiter, nein, wieder differenzieren. Wir müssen dem gerechten Zorn begegnen und dabei helfen, ihn in sinnvoller Weise zu kanalisieren, aber wir dürfen uns nicht massakrieren, auch nicht auf Nebenschauplätzen, wie der Sprache, die niemals gerecht sein kann, weil das keine Eigenschaft eines Werkzeugs ist, sondern eine Eigenschaft derjenigen, die ein Werkzeug anwenden.
Wenn Menschen das Bedürfnis haben, auf die Tatsache hinzuweisen, dass die Welt nicht gerecht ist, indem sie eine besondere Sprache verwenden, dann verdient das Anerkennung und Respekt. Respekt verdient aber auch die Entscheidung, diesen Weg nicht zu gehen, sondern einen anderen zu wählen, der möglicherweise – niemand weiß das – sogar schneller und gerechter zum Ziel führt. Oder sich für einen all der möglichen Zwischentöne zu entscheiden, hin und wieder einen längeren Satz zu sagen oder zu schreiben, ohne dazu erpresst worden zu sein, und ansonsten dort, wo es möglich ist, dabei mitzuhelfen, dass wir alle besser miteinander zurechtkommen.